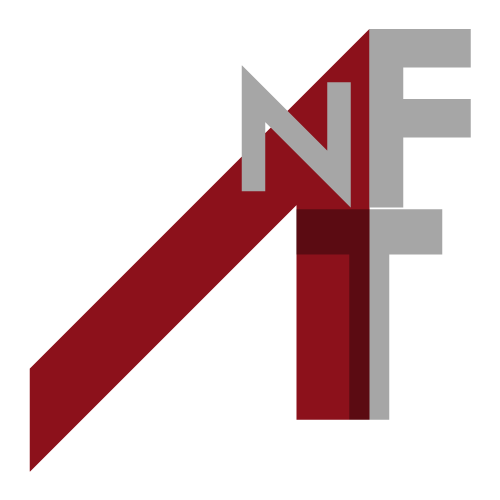Programm
Reduzierung der Arbeitszeit als Grundlage für eine neue soziale Ordnung – 30-Stunden, Vier-Tage-Woche, Sechs-Stunden-Tag
Die zeitliche Beanspruchung durch Erwerbsarbeit gerät zunehmend in Konflikt mit gesellschaftlichen Anforderungen und individuellen Ansprüchen an die Lebensgestaltung Trotz zahlreicher Entlastungen in der Haushaltsführung hat sich das qualitative Spektrum von gesellschaftlichen Anforderungen und individuellen Ansprüchen an die Lebensgestaltung erheblich erweitert Grundlegende gesellschaftliche Ziele wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleiche Chancen von Frauen und Männern im Arbeitsleben, häusliche Pflege, Verlängerung der Lebensarbeitszeit und eine nachhaltige Lebensweise lassen sich nur verwirklichen, wenn die zeitliche Beanspruchung durch die Erwerbsarbeit deutlich reduziert wird. Es geht daher nicht nur um mehr Freizeit, sondern vor allem um mehr Zeit für andere individuelle und gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten und andere Arbeit, wie Erziehung, Care, Eigenarbeit, gesundheitsförderliche und nachhaltige Lebensführung , lebenslanges Lernen , soziales und politisches Engagement und kulturelle Beteiligung.
In der historischen Entwicklung war die Einführung des Acht-Stunden-Tages und die 40-Stunden-Woche eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Erwerbsarbeit zu einer sozial akzeptablen und stabilen Lebensform werden konnte. Zugleich war damit auch eine grundlegende Veränderung der kapitalistischen Produktionsmethoden verbunden. An die Stelle der Ausdehnung der Arbeitszeit trat die Steigerung der Intensität der Arbeit. Auf dieser Grundlage wurde mit der Verkürzung der Arbeitszeit auch eine Steigerung der Einkommen möglich.
Heute geht es erneut darum Erwerbsarbeit dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen und zugleich entstehen mit der Digitalisierung und dem Einsatz von KI neue Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung. Trotz einer deutlich verkürzten Arbeitszeit auf 30 Stunden in der Woche kann daher das Einkommensniveau aufrechterhalten und weiter gesteigert werden. Auch entstehen neue Formen von Arbeit, bei denen die Qualität des Ergebnisses davon abhängt, dass die zeitliche Beanspruchung reduziert wird. Und schließlich trägt die Verkürzung der Arbeitszeit auch zur Bewältigung von personellen Freisetzungen in Folge der Digitalisierung und des Einsatzes von KI bei.
Damit die Arbeitszeitverkürzung ohne Einkommensverlust auch in arbeitsintensiven Bereichen mit geringerer Produktivität möglich wird, ist eine Umgestaltung der Lohnpolitik insgesamt notwendig. Zwischen hochtechnisiert-produktiven und arbeitsintensiven Beschäftigungsbereichen ist ein Ausgleich zu schaffen. Hierzu gilt es die produktivitätsorientierte Lohnpolitik durch eine an sozialer Nützlichkeit und Gerechtigkeit orientierte Lohnpolitik zu ergänzen.
Prof. Dr. Fritz Böhle Forschungseinheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt,
Dr. Ursula Stöger Universität Augsburg,Eichleitnerstr.30, 86159 Augsburg
Fritz.Boehle@phil.uni-augsburg.de Ursula.Stoeger@phil.uni-augsburg.de


Gesundheit
Lebensarbeitszeit
und Pflegearbeit
für Kinder
gerechtigkeit
Arbeit des Alltags
Zivilgesellschaft
und kulturelle
Teilhabe
Konsum
Eigenarbeit und
neue Ökonomien
sicherung